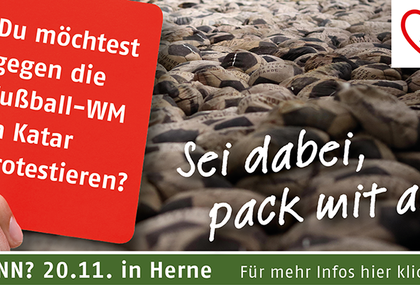Warum ist dieser Welttag so wichtig?
Mädchen und Frauen, die Gewalt erfahren, scheuen sich oft aus Angst vor Stigmatisierung und weiterer Übergriffe davor, über ihre Erlebnisse zu sprechen und diese zu melden. Folglich steigt der Leidensdruck der Betroffenen und die Täter bleiben häufig unentdeckt. Oft finden die Gewalttaten im direkten Umfeld statt. Faktoren wie Armut, unzureichender Zugang zu Bildung sowie Krisen und Konflikte fördern zusätzlich ein Klima von Gewalt. Nach wie vor bestehen vielerorts rechtliche, institutionelle und politische Lücken bei der Beseitigung von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Am 25. November machen die Vereinten Nationen mit dem "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" - auch bekannt als #OrangeDay - jedes Jahr weltweit auf diese Missstände aufmerksam. Die Rechte von Frauen und Mädchen müssen weltweit gestärkt werden. Um dies zu erreichen, müssen auch Jungen und Männer dauerhaft in die Aufklärungsarbeit miteinbezogen werden.

Wie arbeitet AWO International gegen geschlechtsspezifische Gewalt? - Ein Beispiel aus Indien:
In Indien sind Frauen und Mädchen einem besonders hohen Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Gewalterfahrungen erstrecken sich über soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bereiche hinweg und schränken Freiheiten von Frauen ein. In Bowbazaar, einem der größten Rotlichtviertel der Metropole Kalkutta in West-Bengalen, setzt sich AWO International zusammen mit der Partnerorganisation „South Kolkata Humari Muskan“ (kurz: SKHM) gegen geschlechtsspezifische Gewalt ein. Das Viertel ist von Menschenhandel und häuslicher Gewalt geprägt, insbesondere Frauen und junge Mädchen sind betroffen. In dem gemeinsamen Projekt leisten wir vor allem Aufklärungsarbeit. So nahmen Frauen und Männer im vergangenen Jahr an verschiedenen Workshops zu den Themen Menschenrechte und Gewaltprävention teil. Diese Veranstaltungen gaben den Teilnehmer*innen die Möglichkeit, sich über Gewalt und andere Missstände in der Gemeinde offen auszutauschen und Lösungsansätze zu diskutieren. Außerdem errichtete das Projekt einen sogenannten „Safe Space“, einen sicheren Rückzugsraum für Frauen, in dem auch psychosoziale Beratungen angeboten werden. Weiterhin haben sich durch die Unterstützung des Projektes 43 Frauen und Männer in Kollektiven organisiert, in denen Konflikte gleichberechtigt diskutiert und gemeinsam Pläne zur Gründung von Kleinstunternehmen entwickelt werden. Das positive Bild, das durch diese direkte und gewaltfreie Kommunikation der Kollektive entsteht, soll als Vorbild für andere Gemeindemitglieder dienen. So fördert das Projekt gegenseitige Toleranz und kann Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen reduzieren.